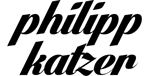Meine Freunde: Der Fahrradkurier
Für eine Subkultur, die eher im Verborgenen bleiben will, ist in diesem Augenblick selbst die dunkelste Ecke der Stadt nicht dunkel genug.
Es ist Mittwoch, ein kalter Abend in der Nähe des ICC, als sich in der Dunkelheit zwei blinkende Gestalten nähern. „Zwo-45 und Triple-6, macht eure Lampen aus“ ruft ihnen jemand aus der Gruppe entgegen, die sich im Schatten einer riesigen Skulptur versteckt. „Wir wollen doch niemanden auf uns aufmerksam machen!“ Für eine Subkultur, die eher im Verborgenen bleiben will, ist in diesem Augenblick selbst die dunkelste Ecke der Stadt nicht dunkel genug. Keiner will, dass die Polizei jetzt noch alles zerstört. Schließlich soll das Rennen in ein paar Minuten starten.
Im Schutz der Nacht fast unbemerkt treffen sich Berliner Fahrradkuriere fast jede Woche zu abenteuerlichen Straßenrennen. Im laufenden Verkehr rasen sie durch die Stadt, Zuschauer, Wegweiser oder gar Straßensperrungen gibt es nicht. „Alleycats“ (engl. streunende Katzen), wie die Rennen in der Szene genannt werden, sind natürlich nicht offiziell angemeldet. Überhaupt wäre nicht klar, welche Straßen gesperrt werden sollten, denn jeder Starter fährt eine andere Route – genau wie im Kurieralltag. In einer Art Schnitzeljagd passieren sie mehrere „Checkpoints“ und müssen dort exotische Aufgaben lösen, wie vorbeilaufende Passanten zum Salsa-Tanzen überreden, stilvoll einen Bikini überziehen oder Berliner Ecken der 20er-Jahren erkennen – jede falsche Antwort wird mit einem Schnaps bestraft!
Heute Abend ist Halloween und am Treffpunkt im Berliner Westen sieht es noch lange nicht nach Aufbruch aus. Im Gegenteil: Ein junger Fahrer, tiefschwarzer Vollbart, roter Helm, baut im schwachen Licht seines Handydisplays einen Joint. Bierflaschen klirren, irgendwo öffnet jemand einen Sekt – von Wettkampfvorbereitung keine Spur. Die Situation erinnert eher an eine junge Touristenmeute, kurz vor dem Start in die Berliner Party-Rushhour. „Triple-6“, den man an seiner rosa-neonblauen Mütze auch im Dunkeln erkennt, klärt auf: „Man darf nicht vergessen, dass ein Alleycat einfach eine schöne Art ist, den Feierabend miteinander zu verbringen.“ Das Gesellige davor und danach sei ein ebenso wichtiger Teil der Kultur, wie das Rennen selbst. „Trotzdem“ entgegnet „Zorro“, der schon seit 28 Jahren als Fahrradkurier arbeitet, „für mich ist es immer auch das Kribbeln, herauszufinden, wer von uns der Beste ist.“
Plötzlich springt ein kleiner Mann auf den Sockel der Skulptur. Es ist Mortimer, der das Rennen organisiert. Unten rücken jetzt alle noch enger zusammen. „Ich begrüße euch zum Jubiläum des Halloween-Alleycats“, sagt „Mo“, wie ihn hier alle nennen. Er ist der Besitzer des Keirin, dem wohl bekanntesten Fahrradladen der Kurierszene. „Es wird heute keine Manifeste geben“ betont „Mo“, überdeutlich. Einige schnaufen enttäuscht. Immerhin ist ein Manifest das wichtigste Dokument eines Alleycats, darauf erfahren die Teilnehmer kurz vor dem Start den Streckenverlauf. „Ihr müsst alles selbst aufschreiben!“
Zettel werden ausgerissen, Stifte im Dunkeln verteilt – Fahrradlampen gehen wieder an. Schlagartig ist es still, die eben noch aufgekratzte Gruppe notiert aufmerksam jedes Wort. Mittendrin fragt jemand: „Die Reihenfolge der Checkpoints ist vorgegeben?“ fast flüsternd. Um selbst klarzustellen: „Das wird ein Baller-Rennen!“ Heute geht es nicht um die bessere Taktik, sondern um die größere Kraft in den Beinen.
Der gesamte Ablauf ist eine Reminiszenz an das erste Halloween-Alleycat vor 20 Jahren. Kein anderes Alleycat in Berlin gibt es schon so lange – es gilt unter den Fahrradkurieren als heimlicher Saisonhöhepunkt. Nicht zuletzt deshalb, weil ausschließlich Kuriere zugelassen sind. Im Gegensatz zu vielen anderen Alleycats. „Mittlerweile werden viele Rennen von Leuten organisiert, die keine Messenger sind“ sagt „M-10“, der vom Kurierfahren seine Familie ernährt. „Letztens war ich bei einem Event, da waren von 60 Startern nur zwei Kuriere!“ „Das stimmt“ meint „Triple-6“, „diese Fake-Messenger kopieren unseren Stil und unsere Fahrräder. Sie fahren bei Alleycats mit und können noch nicht mal vernünftig mit ihren Rädern umgehen!“ Gentrifizierung gibt es scheinbar in allen Bereichen.
Endlich, kurz vor zehn, rennen die Ersten zu ihren Rädern. Taktik absprechen, Packen – ein grandioses Durcheinander. Einige bleiben aber auch einfach stehen, einer macht sich sogar ein neues Bier auf. „Hört mal, das hier ist ein Rennen“ blafft „Mo“ sie an, „ihr könnt hier doch nicht einfach nur rumstehen!“ Dann fängt er selbst an zu lachen.
Rennmodus: on. Tempo 40, den Tiergarten im Rücken, den feuchten Fahrtwind im Gesicht. Sprung vom Bordstein, kurze Stille, zack, ein Knacken, der Rahmen federt alles ab. Rauf auf den großen Stern. Sechs Spuren, kaum Verkehr. Gerade rüber. Kurze Orientierung: Wo sind die anderen? Schneller Blick rechts links: Da kommt ein weißer Kleinbus, aber der bremst. Bordstein zur Mittelinsel hoch: Checkpoint 2, Siegessäule, kurz nach zehn.
Der Marschall sieht die führende Gruppe schon von weitem kommen. Sein Checkpoint liegt leicht erhöht, genau am Fuß der illuminierten Säule. Gerade hat er noch die Kandelaber am Kreisel gezählt, jetzt ist ganz da. Der Marschall ist eine der wichtigsten Institution eines Alleycats – er ist Schiedsrichter, Zechkumpan und Gegenspieler zugleich: Zum Marschall immer freundlich sein, lautet die eiserne Regel, sonst disqualifiziert er dich!
Die vier Kuriere werfen fast gleichzeitig ihre Räder auf den nassen Beton, rennen die flachen Stufen hoch: Tap, tap – tap, tap. Mit den Plastiksohlen der Fahrradschuhe klingt es fast wie Flamenco. Oben bekommt jeder hastig eine Spielkarte in die Hand gedrückt. „Und das Passwort?“ fragt „Drei-5“, der eigentlich Johannes heißt und eine pinke Perücke trägt. „Dead Kennedys – eine Ami-Punkband“. Noch ein kurzes Gespräch mit dem Marschall, dann schnell wieder aufs Rad, zurück auf die leeren Straßen. „Berlin ist wie ausgestorben heute Nacht“, ruft „Drei-5“, schon im Wegfahren, „so lässt es sich herrlich heizen!“ Vorbei an den leichten Mädchen, die niemals zu frieren scheinen, zum Brandenburger Tor und weiter Richtung Oberbaumbrücke durch die nächtliche Stadt.
Steff, der Marschall, blickt ihnen hinterher. Er ist 47, fährt selbst noch Kurier, aber seit einem Unfall bei einem Alleycat vor fünf Jahren keine Rennen mehr. „Das Risiko ist immer dabei“ sagt er. Auch beim letztjährigen Halloween-Alleycat hat es zwei heftige Stürze gegeben, schwere Verletzungen sind aber selten. Und obwohl Steff nicht mehr selbst mitfährt, kann er sich gut an die Magie der Rennen erinnern: „Gemeinsam durch die Nacht, das ist großartig!“ Wie bei Graffiti-Sprühern, die auf der Lauer liegen; wie bei Freunden, die gemeinsam die Nacht durchtanzen.
Kurz darauf schießen aus drei Richtungen gleichzeitig kleine Radler-Gruppen auf die Siegessäule zu. Wie die Herolde, die Boten des Mittelalters, sind sie offensichtlich mit einer Art Uniform ausgestattet. Die Insignien der Kuriere: Hochgeklappte Fahrradmützen und bunte Trikots, Funkgeräte und riesenhafte Umhängetaschen, kurze Hosen mit vielen Taschen – auch im Winter.
Unter den Berlinern haben die Fahrradkuriere einen widersprüchlichen Ruf: Viele halten sie für rücksichtslose, aggressive Draufgänger. Die ZEIT nannte sie einst „marodierende Söldner der Großstadt“. Für die jüngere Generation sind sie dagegen urbane Avantgarde, unabhängige Freiberufler, die den ganzen Tag an der frischen Luft arbeiten. Ungefähr 250 bis 300 Fahrradkuriere gibt es momentan in Berlin, die Mehrheit davon fährt für die vier größten Dienstleister Go, Cosmo, Twister und Messenger.
Die Szene ist stark vernetzt und sehr intim, jeder kennt jeden; es hat sich ein eigener Mikrokosmos gebildet. Während der Schicht trifft man sich in Läden wie dem Keirin in Kreuzberg, hängt zusammen am „Olli“ ab, dem Olivaer Platz in Charlottenburg. Am Abend trinkt man ein Bier auf dem „Platz des himmlischen Kurierfriedens“ an der Ecke Alte Schönhauer-/Linienstraße in Mitte. Und ein paar Mal im Monat steigt dann ein Alleycat, die Leistungsschau der Fahrradkuriere – irgendwo in der Stadt. Berlin gilt neben New York als das Zentrum der internationalen Alleycat-Bewegung. Hier fand 1993 sogar die erste Fahrradkurier-WM statt.
Als oben auf dem grünen Viadukt wieder eine Bahn Richtung Kreuzberg schleicht, entscheidet „Drei-5“ einige Meter darunter das Rennen. Am letzten Checkpoint, einem kleinen Park zwischen Spreeufer und Oberbaumstraße, kommt er ein paar Sekunden schneller los als seine drei Begleiter. Weil er auch eine andere Route wählt, wird er das Alleycat später gewinnen.
Zurück lässt die Gruppe die unheimliche Finsternis, die wie ein graublauer Mantel über den hohen Sträuchern liegt. Ein paar verstreute Konzertbesucher vor dem Magnet-Club nehmen das rot-weiße Blinken der Fahrradlichter nicht wahr. Auch am Schlesischen Tor bleibt Berlin heute Nacht irgendwie leer, obwohl Halloween ist. Vielleicht hat die Stadt schon den November-Blues.
Letzter Akt. „Agatha“, eine gar nicht so üble Neuköllner Spelunke. An der Theke drängen sich drei junge Burschen, „Amsterdam“, „Brooklyn“ und „Warszawa“ steht vorne auf ihren Fahrradmützen. Wenigstens hier im Zielbereich kann man die Gesichter der Fahrer erkennen. Alle sind irgendwie euphorisch, auch erschöpft, „Triple-6“ hat rote Striemen im Gesicht von der Kälte. Zwischen den verschwitzten Körpern mischt sich der Geruch von feuchtem Nylon, Rauch und warmen Linoleum. Fast könnte man jetzt sentimental werden bei dem Gedanken, wie gut hier alles zusammenpasst. Vor der Tür der „Agatha“ kreist eine Flasche mit „Pfeffi“-Likör, mittlerweile ist Mitternacht, als der Sieger spricht: „Eigentlich geht es beim Alleycat-Fahren nur um die Ehre“, sagt „Drei-5“, während er die pinke Perücke zurechtschiebt, „und das Bierchen danach.“
Diese Reportage ist zuerst im tip Stadtmagazin erschienen.